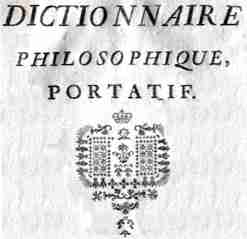Im Chinesischen Katechismus gibt Voltaire einen Einblick in aktuelle Positionsbestimmungen der Aufklärung zum Christentum.
Zu der aus dem Humanismus stammenden zentralen Aussage, dass die Menschen bei ihrer Verbindung zu Gott keine vermittelnde Institution benötigen, kommt im 18. Jahrhundert die klare Ablehnung der Gottesidee selbst hinzu, wie sie de Meslier, de La Mettrie, Diderot, d’Holbach und d’Alembert, formulierten, außerdem die Suche nach einer humanen, nichtchristlichen Ethik. Diese Positionsbestimmung wird auf verschiedenen Ebenen vorgenommen:
1. Auf der Ebene der christlichen Religion selbst: Welche Argumente gibt es für die Existenz ihres Gottes (Alleine, dass man an diese Frage verstandesmäßig herangeht, war für die Kirche ein erster Schritt zum Scheiterhaufen) und welche Argumente halten einer rationalen Überprüfung stand?
2. Auf der Ebene des Subjekts: Wie kann man sich den Kontakt des einzelnen Menschen zu Gott im Christentum vorstellen?
3. Welche Bedeutung kommt der christlichen Religion in Bezug auf die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu?
4. Mit welchem Recht behauptet die christliche Kirche, Vertreterin der einzig wahren Religion und Gottesidee zu sein? Da es mehrere Religionen und mehrere Religionsgemeinschaften/Kirchen gibt: Wie kann ihr Zusammenleben, wenn doch jede ihren Gott für den einzigen hält, organisiert werden?
Zumindest für die Ebenen 3 und 4 war China bedeutend, weil dort selbst nach den Berichten der Jesuiten (siehe unseren Kommentar zum Artikel Über China) ein Staat existierte, der seit Jahrhunderten völlig ohne Religion und Kirche, insbesondere ohne das Christentum auskam und nach seinen eigenen konfuzianischen nicht-religiösen Grundsätzen funktionierte. Deshalb kleidet Voltaire diese für die Aufklärung entscheidende Diskussion in ein chinesisches Gewand. Die Entdeckung Chinas und der dortigen Lebensweise war ebenso überwältigend, wie wenn man heute einen fremden Planeten entdeckte, auf dem die Menschen völlig friedlich, bei gemeinschaftlicher Herstellung und Verteilung des Reichtums, genüsslich lebten – und das alles mit 20 Stunden Arbeit pro Woche….
Hintergrund:
A.
Die alltägliche Verfolgung von Religionskritikern steht im Hintergrund des Chinesischen Katechismus, die Voltaires Vorsicht, sein Zurückweichen zum Schluss eines jeden der ersten drei Gespräche dieses Dialogs, verständlich machen. Zwei Beispiele für die existentielle Bedrohung von Philosophen der Aufklärung seien hier exemplarisch aufgeführt, auch das Leben de La Mettries gehört hierher, der sich vor den christlichen Häschern an den Hof Friedrich II. nach Berlin retten konnte, um dort als dessen Vorleser und Spassmacher zu fungieren:
Die Verfolgung von Christian Wolff, Mathematikprofessor und Prorektor der Universität Halle
Wolff wurde nach seinem Vortrag mit dem Titel: Rede über die praktische Philosophie der Chinesen (12. Juni 1721) von der Universität und aus Preußen überhaupt verbannt. In seinem Artikel De La Chine berichtet Voltaire von dem empörenden Vorgang und zeigt Wolff als Märtyrer der Aufklärung, Opfer des verfolgerischen Christentums. Seinen Chinesischen Katechismus, insbesondere den zweiten Teil, kann man als Ergänzung zu Wolffs Rede lesen. Voltaire war mit Christian Wolff durch seine Lebensgefährtin Emilie du Châtelet, eine Wolffianerin, intensiv befasst und er besuchte ihn sogar in Halle. Er teilte nicht dessen Ansicht von unserer Welt als der besten aller möglichen und auch nicht Wolffs Hoffnung, Gott und die Religion verstandesmäßig, mit mathematischer Genauigkeit begründen zu können.
Dies sind die Thesen von Christian Wolff die er in seiner Rede vertritt, in der er seine starke Übereinstimmung mit Konfuzius aufzeigt (Wolff bezieht sich dabei – wie später auch Du Halde in seinen Bericht über Konfuzius – auf François Noël ):
– wie schon Konfuzius lehrt, ist es dem Einzelnen möglich, zu erkennen, was gut und was böse ist. Dieses Erkenntnisvermögen zu schulen ist eine wichtige, lebenslange Aufgabe
– den Menschen ist (Ethik der Autonomie) das Erkenntnisvermögen „ins Herz geschrieben, sie selbst sehen, was gut ist“, das wirklich tugendhafte Handeln, resultiert aus der Vernunft und nicht aus der Furcht vor einem Herren, nicht als Reaktion auf Belohnung oder Strafe: (Woher die Tugend kommt).
„Wer durch die Vernunft zum Guten angetrieben wird, der wird durch den freien Willen zu guten Handlungen bestimmt und braucht, um beim guten zu bleiben, keinen Herren“ (S.37 V 436 f).
– Zur Vollkommenheit gelangt man durch nicht durch ständiges Bekämpfen des Bösen/der Laster, sondern durch beständiges Fortschreiten in der Erkenntnis, im Gebrauch der Vernunft. Die Erprobung dieser Grundsätze, könne man, meint Wolff, „nirgendwo sicherer auffinden als bei den alten Chinesen, bei denen es überhaupt keine Religion gab“(S.47, V. 615). Prof Heiner Roetz (Univ. Bonn) schrieb 2021 in einem Aufsatz zum 300 jährigen Jubiläum der Rede Wolffs: „Wolffs China-Rede war eine der seltenen Sternstunden einer zukunftsweisenden kosmopolitischen Philosophie. Seine Liaison mit dem Konfuzianismus hat nicht nur dazu beigetragen, die Ethik von ihrer Bevormundung durch die Theologie zu befreien, sondern auch dazu, sie auf den Pfad der Autonomie zu bringen“.
Lit.: Heiner Roetz, Menschen brauchen keine Religion und keine Gesetze – „Sie sehen selbst, was gut ist“ 08.07.2f021 (Heiner Roetz ist emeritierter Professor für Geschichte und Philosophie Chinas an der Universität Bochum).
Die Inhaftierung von Denis Diderot wegen seinem Brief über die Blinden zum Gebrauch für die Sehenden , 1749
Kurz nach der Veröffentlichung seines Textes wurde Diderot am 24.7.1749 verhaftet und in dem Gefängnis Vincennes inhaftiert, aus dem er erst am 3. November 1749 wieder entlassen wurde. In dem Brief über die Blinden geht es um die Frage, wie es mit der Allmacht Gottes zu vereinbaren sei, dass es Menschen gibt, die von Natur aus blind sind. Ausgehend von John Lockes Versuch über den menschlichen Verstand, nachdem in der Welt unseres Verstandes nichts existiert, was nicht auf einer sinnlichen Wahrnehmung beruht, bezweifelt er, dass man Gründe für die Annahme der Existenz eines allmächtigen Gottes finden könnte. Wenn man die Existenz Gottes, wie es der Deismus tut, aus der bewundernswerte Harmonie der Welt und ihrer unveränderlichen (Natur-) Gesetze ableitet, welche Stellung nehmen dann in dieser Welt die von Natur aus Blinden ein? Ausgehend von dieser Frage kommt er zu einem grundsätzlichen Zweifel an der christlichen Schöpferidee. Wenn es aber keinen allmächtigen Gott gibt, sind auch unsere Ideen über das Böse und das Gute nicht absolut gültig, sondern relativ. Auch sie sind abhängig von unserer körperlich-sinnlichen Wahrnehmung. Diese, in die Worte eines Blinden gekleidete Argumentation war ausreichend, um Diderot ins Gefängniss zu werfen. (siehe dazu: Pierre Lepape, Denis Diderot, Frankfurt: Campus, 1994,S.8-16, S.88 ff, er folgt: Paul Bonnefon, Diderot prisonnier à Vincennes, in: Revue d’histoire littéraire de la France, Juli-Sept. 1899; einige der Briefe der Buchhändler und Verleger, die sich für die Freilassung Diderot einsetzten, findet man (frz.) in ARTFL, einem US-amerikanischen Projekt zur Digitalisierung bedeutender französischsprachiger Texte) .
B.
Außerdem sollte man sich den religiösen Hintergrund für die sechs Gespräche des Chinesischen Katechismus vor Augen führen:
1. Gespräch: Der Himmel als „Wohnung Gottes“ ist der Ort, wo die Guten landen während die Hölle für die Schlechten ist (Das christliche Glaubensbekenntnis: „ich glaube an Gott, …den Schöpfer des Himmels und der Erde…..“)
2. Gespräch: Gott als Schöpfer der Welt ist dem Christentum zufolge allmächtig („ich glaube an den allmächtigen Gott…“)
3. Gespräch: Die Seele ist der unsterbliche Teil des Menschen und wird nach dem Tod entweder aufsteigen oder muss, besonders wenn sie nicht getauft ist, in der Hölle schmoren. („ich glaube an die Auferstehung der Toten … und an das ewige Leben.“, Jesus wird „richten die Lebenden und die Toten.“)
4. Gespräch: Das Christentum ist der einzig wahre Glauben und seine religiösen Grundsätze stehen über den weltlichen Gesetzen. Keiner anderen Religion soll es erlaubt sein, über der christlichen zu stehen. („ich glaube an die heilige/christliche– katholische Kirche“)
5. Und 6. Gespräch: Glaube, Liebe und Hoffnung gelten dem Christentum als die höchsten Tugenden.
Die folgenden Anmerkungen zu einzelnen Textstellen beziehen sich mit ihren Seitenangaben auf die von uns bei Reclam herausgegebene Ausgabe des Philosophischen Taschenwörterbuchs (2020):
Erstes Gespräch
Anmerkung 1 Titelerklärung (S.108):
– Zisi, auch Tse Sse (481 – 402 vuZ) war der Großenkel von Konfuzius.
– Voltaires Dialog fußt auf der Description de la Chine von J.-B. Du Halde, in der er das vierte der klassischen Bücher (Meng Tsée, ou livre de Mencius) vorstellt, das ihm in der Übersetzung von François Noël vorlag. Mengzi (um 370–290 v. Chr.), einer der bedeutendsten Konfuzianer, unterweist dort diverse Adlige in der Kunst des guten Regierens. Diese Dialoge des Mencius waren ganz offensichtlich das Vorbild des Chinesischen Katechismus.
– Jean-François Fouquet, Jesuit, (1655-1741) hielt sich von 1710 bis 1717 in Peking auf. Er ist der Verfasser von Abhandlungen über das Tao, über Konfuzius. Einige seiner Manuskripte befinden sich in der Bibliothek des Vatikans.
Anmerkung 2 (S.108 „Himmel (Shangdi)“):
Der Begriff Shangdi https://en.wikipedia.org/wiki/Shangdi geht auf das zweite chinesische Kaiserreich zurück, die sogenannte Shang Dynastie (18. – 11. Jhdt v.u.Z.) deren Kaiser auf Orakelknochen genannt und offenbar göttlich verehrt wurden. Der Kaiser so glaubte man, empfing sein Herrschermandat vom Himmel und kehrte nach seinem Tod an die Seite des „Shangdi“ zurück. Weil diese Vorstellung der christlichen vom Gottkaisertum und von Gott als dem „Schöpfer des Himmels und der Erde“ fast vollständig entspricht, kann sie hier als „chinesische“ gefahrlos lächerlich gemacht werden.
Anmerkung 3 (S.111 oben „… die Strahlen, die von Ihren Augen bis zum Scheitelwinkel zwei gleiche Winkel bilden“): Gemeint sind die beiden Geraden, die vom Rand eines Gegenstands zum Auge führen, dort im Scheitelpunkt zusammenkommen und sich im gleichen Winkel in das Innere des Auges fortbewegen, wo sie auf die Netzhaut treffen. Die Natur des Lichts wurde im 18. Jahrhundert von Newton erforscht und beschrieben. Voltaire machte die Entdeckungen Newtons bereits 1732 in seinen Philosophischen Briefen bekannt. Später bauten er und seine Lebensgefährtin Emilie du Châtelet die Experimente Newtons in ihrem physikalischen Labor in Cirey nach und überprüften seine Aussagen. Ihre Ergebnisse veröffentlichte Voltaire die Eléments de la philosophie de Newton (1738). Emilie du Châtelet wiederum übersetzte bis kurz vor ihrem Tod im Jahr 1749 Newtons Principia Mathematica vom Lateinischen ins Französische: Principes Mathématiques de la Philosophie naturelle par feue Madame la Marquise du Chastellet, Paris: Desaint & Saillant, Lambert, 1756 Vol 1, 417 p. vol 2 297p.
Zweites Gespräch
Anmerkung 4 (S.114 Zisi: „Die (Regeln) des Konfuzius…“): Voltaire zitiert die beiden Regeln aus dem Lun-yu (Buch der Gespräche), dem zweiten kanonische Buch der konfuzianischen Lehren, wie es Du Halde präsentierte. In der Übersetzung von Buch XI: „Einer bat, dass er ihn lehren möge, wohl zu sterben, so sagt er: Ihr habt noch nicht angefangen wohl, lernet dieses, so wisset ihr auch wohl zu sterben“; Buch XII: „Gehet mit anderen so um, als ihr es euch selbst von anderen wünschet“
Anmerkung 5 (S. 115 Gu: „So wird ihnen Gott erlauben böse zu sein…?)
Wie das Böse in die Welt kam, wenn doch Gott allmächtig ist, war – nicht nur im 18. Jhdt. – eine vieldiskutierte Frage. Leibniz schrieb ein ganzes Buch (die Theodizee) darüber und kommt zu dem Schluss, dass Gott die beste aller möglichen Welten geschaffen haben musste, in der das Böse eben vorkommt. Siehe dazu den Artikel Tout est bien – Alles ist gut und unsere Kommentarseite dazu.
Anmerkung 6 (S. 115 Gu: „Aber wenn ich sicher bin, dass es überhaupt keines [anderes Leben nach dem Tod] gibt?“): Das zweite Gespräch mündet in einer atheistischen Position, was im 18. Jhdt. ziemlich gefährlich war. Vielleicht deshalb wird sie von Voltaire mit dem klassischen Winkelzug der Beweisumkehr, dass der Zweifelnde beweisen soll, dass es Gott, oder ein anders Leben nicht gibt, entschärft.
Drittes Gespräch
Dieses Gespräch ist ein gutes Beispiel dafür, wie Voltaire sich hinter seinen Protagonisten versteckt, mal ist er Gu, mal ist er Zisi. Vertritt Voltaire atheistische, gotteslästerliche Meinungen? Nein, nur Gu vertritt sie (S.120)…Zisi tritt ihnen entgegen, aber schon die Antwort Gus (S.121) ist wieder eine original Voltairesche Position usw. Deshalb ist es so schwer herauszufinden, wie weit Voltaire in seiner Religionskritik wirklich ging. Deshalb waren zwei ausgewiesene Voltaire Experten Pomeau (er hält Voltaire für eine Deisten) und Bestermann (er hält ihn für einen Agnostiker) gegensätzlicher Meinung. Siehe dazu unser Exzerpt der Dissertation von Pomeau: La Réligion de Voltaire.
Anmerkung 6 (S. 116 Gu: „Ist also die Seele…selbst nichts als ein Wort?“): Siehe dazu den Artikel Âme – Seele und unsere Kommentarseite dazu, außerdem die Diskussionsbeiträge zum Thema Die Seele im 18. Jhdt.
Anmerkung 7 (S. 119 Gu: dass wir immer Vorstellungen haben, auch wenn wir schlafen): Siehe dazu den Artikel Songes – Träume,
Anmerkung 8 (S. 120 oben, Zisi: „..haben Sie einen Willen und sind frei“): Über die Freiheit des Menschen s. den Artikel De La Liberté – Über die Freiheit.
Anmerkung 9 (S. 120 unten, Zisi: „..Deshalb ist es nötig, dass das Gute und das Schlechte ihr Urteil in einem anderen Leben finden“): Diesen Gedanken äußert Voltaire an etlichen Stellen, er unterstützt die disziplinierende Funktion der Religion und hofft, dass sie hilft, die Aggressionen des Volkes einzudämmen. Über Funktion des Glaubens an eine „jüngstes Gericht“ siehe unsere Zusammenfassung von R. Pomeau, La Religion de Voltaire, S. 398-406 und den Art. Enfer -Hölle.
Anmerkung 10 (Gu: “..zweihundert Familien ehemaliger Sionous..“): Eine Stadt, in der Juden seit dem 8., 9. Jh. lebten, war Kaifeng. Sie waren über die Seidenstraße gekommen. Die dortige Synagoge wurde von einem Franzosen, dem Jesuitenpater Jean Domenge, 1722 gezeichnet. Voltaire konnte von ihrer Existenz bei Du Halde (Description de la Chine, III, 64 b) erfahren.
Viertes Gespräch
In diesem Gespräch stellt Voltaire mit Hilfe der jesuitischen Kritik an den Konkurrenzreligionen, wie sie Du Halde wiedergibt, bevor er die jesuitische Mission in den höchsten Tönen lobt, die Absurditäten nicht nur jener, sondern auch der jesuitischen Glaubenserzählungen bloß. Die chinesische konfuzianische Lehre schneidet dagegen außerordentlich gut ab.
Anmerkung 11 (S. 123 oben, Zisi: „Sie opfern [dem Shangdi] vier mal im Jahr“): Du Halde beschreibt ausführlich die Frühlingszeremonie, bei der der Kaiser wie ein Bauer die Saat mit fünf verschiedenen Körnern ausbringt, um sie im Herbst zu ernten.
Anmerkung 12 (S.123 Gu: „fette Bergweisen, die nicht betrachtet werden dürfen“): Ironische Anspielung auf den Psalm 67, Vers 17 n.d. Bibelübersetzung von Lemaistre de Sacy : https://fr.wikisource.org/wiki/Bible_Sacy/Psaumes#CH068 „Was schaut ihr bewundernd auf Berge, die fett und fruchtbar sind?“ Voltaire beginnt mit den Absurditäten des Christentums.
Anmerkung 13 (S.123 Gu: „wenn ich den Mond zum Stillstand gebracht haben werde“):
Bezieht sich auf das Alte Testament, Josua, Kap. 10, Vers 12-13 „Sonne stehe stille zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon! Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte.“
Anmerkung 14 (S.123, Gu: „Einerseits sehe ich Laotse…“): Über die sagenumwobene Geburt des Laotse und seine weißen Haare berichtet Du Halde (1735, III, 49; dt. III, S. 63 ; was die Lehre von der Vernichtung angeht, bezieht sie Du Halde in dem direkt auf Laotse folgenden Paragraphen ((1735, III, p.49; dt. III, S. 64 §116) auf Fo, d.i. Buddha: „Sehet ihr aber nicht, dass diese schöne Lehre von der Vernichtung seiner selbst, von der allgemeinen Entäußerung endlich auf eine chimärische Unsterblichkeit und auf ein solches Verlangen hinauslaufe, das nie erfüllt werden kann“.
Anmerkung 15 (S.124 Gu: „…Phantastereien von den Bonzen…“): Du Halde macht deutlich, wie die (buddhistischen) Bonzen das Volk täuschen, er beschreibt ihre Selbstkasteiungen und erzählt eine Anekdote, nach der sich ein Bonze auf einen ganz mit Nägeln besetzten Stuhl setzte und er berichtet von anderen, die sich dicke Ketten von mehr als 30 Fuß Länge um Hals und Füße hatten anbringen lassen. (Du Halde, 1735, III, 24 a + b; dt.: Du Halde III, S.32,33 §60 u. 61)
Anmerkung 16 (S.124 Mitte, Gu: „dass es besser ist, Gott mehr als den Menschen zu gehorchen“): Das ist die Antwort, die Petrus und die Apostel im Tempel dem Hohenpriester geben (Apostelgeschichte 5,29): „Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem [christlichen] Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“
Anmerkung 17 (S.124, Zisi: „Der Shandi bewahre mich davor, in Ihnen den Geist der Toleranz …auslöschen zu wollen“): Siehe den Artikel Tolérance -Toleranz.
Anmerkung 18 (S.125, Zisi: „Die chaldäischen Priester…behaupteten, ein berühmter Hecht namens Oannes habe sie einst die Theologie gelehrt“): Oannes, halb Mensch, halb Fisch, ist ein Götterbote der babylonischen Religion aus den Anfängen der Zeit, wie von Berossos (302- v.u.Z.) berichtet und von Abbé Bannier erzählt wird. Es ist offensichtlich, dass Voltaire die Geschichte als Schablone benutzt, um sich über die scholastischen Grübeldebatten lächerlich zu machen.
Fünftes Gespräch
Anmerkung 20 (S.128, Gu: Könige die 300 Frauen haben, kommen nicht zu den Staatsgeschäften):
Das ist eine Anspielung auf den König Salomon und seine legendäre Polygamie (AT, I. Könige, 11, 3)
Während für Voltaire einerseits die Polygamie abzulehnen ist, kritisiert er ebenfalls das katholische Zölibat als gegen den prosperierenden Staat gerichtet. Der Abbé Saint-Pierre (=Charles Irénée Castel de Saint-Pierre) forderte dessen Abschaffung (Ouvrages de politique, vol 2, V. Observations politique sur le célibat des prêtres, Rotterdam 1733-1741 p.150-183)
Anmerkung 21 (S.128: Gu: 50 Eunuchen, um in der Pagode zu singen):
Wieder versteckt Voltaire seine Kritik an der Kirche, diesmal hinter dem Dalai Lama. Mit den Verstümmelten des Dalai Lama sind deutlich die Jungen gemeint, die man noch im 18. Jhdt. auf Befehl des Papstes kastrierte, um sie als Sopranisten im Chor des Vatikans einzusetzen (siehe: Ambrosini, Maria Luisa, Die Geheimen Archive des Vatikans, München Kösel, 1972, S.188 f. Der Autorin zufolge wurde die Jungen-Kastration von Benedikt XIV abgeschafft, andere bekannte Kastraten im 19. Jahrhundert deuten auf einen wesentlich längeren Fortbestand der Praxis hin. Als letzter Kastrat des Vatikans gilt ein gewisser Alessandro Moreschi, der von 1858 -1922 lebte) .
Anmerkung 22 (S.130: die Freundschaft):
Die Freundschaft gehört bei Konfuzius zu den fünf elementaren menschlichen Beziehungen und ist die einzige Beziehung unter Gleichrangigen. Siehe dazu auch den Artikel Amitié – Freundschaft
Anmerkung 21 (S.131 Zisi: „dass unsere guten Handlungen nur glanzvolle Sünden seien“):
In seinem Kampf gegen den Pelagianismus Julians spricht Augustinus (Contra Julianus Plegianus) den Ungläubigen ab, tugendhaft sein zu können. Sie haben vielleicht ihre Pflichten erfüllt, aber nicht wirklich Gutes getan, sondern ihre Taten waren alle mehr oder weniger schwere Sünden, weil ihnen der christliche Glaube fehlte. Ein schlechter Baum bringt keine guten Früchte hervor. S. dazu Johann Ernst, Augustinus gegen Julian, S.80 fff
Sechstes Gespräch
Anmerkung 23 (S.132, Zisi: Lob der Gastfreundschaft): Viele der frühen Chinareisenden berichteten über die große dort herrschende Gastfreundschaft, insbesondere die der kostenlosen Unterkünfte – Voltaire hat diese Einrichtung in das Eldorado seines Candide übernommen.
Anmerkung 24 (S.134, Sammoncodom lässt die Drachen steigen): Sammonocodom ist zwar nach der Enzyklopädie der siamesische Name für Buddha, doch soll er bereits lange vor Christi Geburt der Gott der Siamesen gewesen sein und sich in 550 Tieren inkarniert haben. Voltaire folgt dem jesuitischen Missionar Guy Tachard (Voyage de Siam, Paris 1686), der mehrfach nach Siam gereist war. Von ihm stammt die Geschichte über Sammonocodom, der Drachen steigen lässt und den Bäumen befiehlt, dabei nicht zu stören.
Anmerkung 25 (S.134, die Kamis, die vom Mond herunterkamen): Die Kamis sind im japanischen Shintoismus verehrte Geister oder Götter. Voltaire bezieht sich auf Engelbert Kaempfer (1651-1716), einer der ersten Europäer, die Japan bereisten. Er wurde Leibarzt des Grafen Friedrich Adolf zur Lippe, weshalb er nicht dazu kam, alles zu veröffentlichen. Erst nach seinem Tod wurden einige seiner Manuskripte veröffentlicht, Teile seines Nachlasses wurden vom Leibarzt des englischen Königs Sir Hans Sloane gekauft, übersetzt und als The History of Japan 1727 publiziert. Bereits 1729 erschienen die ersten Auflagen einer französischen Übersetzung und Christian Wilhelm Dom brachte 1777-79 unter dem Titel Engelbert Kaempfers Geschichte und Beschreibung von Japan bei Meyer in Lemgo eine deutsche Version heraus. Ausführlich dazu der Wikipediaeintrag Engelbert Kaempfer.