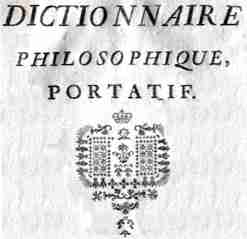Wenn wir mit dieser Buchempfehlung eine Ausnahme von unserem Prinzip machen, nur Werke zu besprechen, die sich direkt auf Voltaire und die Aufklärung beziehen, so liegt dies an der besonderen Bedeutung dieses Buches für alle, die der Aufklärung nahe stehen.
Hoevels verlässt mit diesem zweiten seines auf drei Bände konzipierten Hauptwerkes die engere ökonomische Marxismustheorie und weitet den Horizont hin zu einer welthistorischen Analyse der Ideologieproduktion, in marxistischer Diktion also des gesellschaftlichen Überbaus.
Vergleicht man das Werk mit dem Essay sur les Moeurs et l‘Esprit des Nations von Voltaire, in dem er dem Einfluss von Religion und Kirche auf unsere Kultur nachgeht, verfolgt Hoevels ein ähnliches Ziel, insbesondere aber das eine, Übersicht zu gewinnen und zu vermitteln über die Funktionsgrundlagen der europäischen Kultur. Und wie schon Voltaire, bezieht er die außereuropäische Kulturgeschichte ein, setzt sie in Bezug zu unserer europäischen, um diese besser verstehen zu können. Denn es ist der Vergleich, der allem wissenschaftlichen Denken den Weg weist.
Author: Rainer Neuhaus
Priskil, Peter: „Zwölf Humanisten“, Der verdrängte Humanismus, II. Band, Freiburg: Ahriman, 2022, 616 S.; bereits 2019 erschien der 1. Band „Der verdrängte Humanismus“, 224 S.
Rezension von Rainer Neuhaus
Nach seiner Vorstellung der Karmaten als eine der ersten Gesellschaften, die ohne religiöse Bevormundung auskam (Die Karmaten, siehe die hier veröffentlichte Rezension), arbeitet der Historiker und Publizist Peter Priskil in seinem zweibändigen Werk in gewissermaßen archäologischer Feinarbeit heraus, welche Bedeutung der Humanismus und die in seinem Namen handelnden Personen für das Niederringen der christlichen Bevormundung in Europa und damit für die Aufklärung hatte. „Archäologische Feinarbeit“ ist das vor allem deshalb, weil die Suchgrabungen durch einen ungeheuren Wust von Schutt und Müll vorangetrieben werden müssen, der über die letzten Jahre leider nicht geringer wurde, sondern an Umfang und absichtlich gelegten falschen Fährten immer weiter zunahm.
„Priskil, Peter: „Zwölf Humanisten“, Der verdrängte Humanismus, II. Band, Freiburg: Ahriman, 2022, 616 S.; bereits 2019 erschien der 1. Band „Der verdrängte Humanismus“, 224 S.Rezension von Rainer Neuhaus“ weiterlesen
Voltaire-Übersetzer: Wilhelm Christhelf Sigmund Mylius
Wilhelm Christhelf Sigmund Mylius, (* 2.5.1754 in Berlin – † 31.3.1827 in Berlin). Sein Vater war der Jurist Christhelf Mylius (1733 – 1777), seine Mutter Dorothea Spener. Seltsamerweise benutzt weder der Wikipediaartikel noch das Germersheimer Übersetzerlexikon die Geschichte der Familien Mylius‚ (von Johann Carl Mylius, Buttstädt 1895), die wir unserer kurzen Vorstellung hier zugrunde legen.
Wie sein Vater studierte W.C. S. Mylius zunächst Jura, begann aber nach dem Tode des Vaters mit seiner Übersetzertätigkeit. Er übersetzte aus dem Französischen (Molière, Le Sage..), aber auch aus dem Englischen und Lateinischen (ausführlich dazu der Artikel im Germersheimer Übersetzerlexikon).
Besonderen Verdienst erwarb er sich als Übersetzer (gemeinsam mit S..r und B..e [evtl. Johann Joachim Christoph Bode]) und Herausgeber der bis heute umfangreichsten, 29 bändigen Voltaire Werkausgabe in deutscher Sprache (Voltair’s, Sämmtliche Schriften. Übersetzt von Wilhelm Christhelf Sigmund Mylius u.a., 29 Bd. Berlin, (Wever [Sander]) 1786-1794.).
Voltaires Candide übersetzte Mylius 1778 – er war damals gerade einmal 24 Jahre alt. Es ist eine sehr freie Übersetzung , die sich bis in unsere Zeit gehalten hat und immer wieder nachgedruckt wurde. Hier, wie Mylius zwei unserer „Referenzstellen“ (aus der Rezension v. R. Neuhaus der Candide-Übersetzung von Tobias Roth aus d. J. 2018) ins Deutsche übertrug:
1. Voltaire: Remarquez bien que les nez ont été fait pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes.
Mylius: „Betrachtet zum Beispiel Eure Nasen. Sie wurden gemacht, um Brillen zu tragen und man trägt auch welche.“
Das wäre auch so gegangen: „Merkt Euch, daß Nasen dazu gemacht sind, Brillen zu tragen, daher trägt man auch welche.“
2. Mylius‘ Übersetzung des dritten Satzes des Candide (Il avait le jugement assez droit, avec l’esprit le plus simple; c’est, je crois, pour cette raison qu’on le nommait Candide) zeigt seht gut, wie selbstbewußt er mit dem Text umging:
„An Kopf fehlte es ihm eben nicht und doch war er offen, rund, und ohn alles Arg. Eben deswegen, glaub‘ ich, nannte man ihn – die Französische Sprache ist ja einmal die Muttersprache der teuschen Grossen – Candide, welches verdolmetscht heisst Bieder oder Freimut.“ Das würde sich heute kein Übersetzer mehr getrauen.
Mylius starb unverheiratet und in ziemlicher Armut in Berlin am 31. März 1827.
Philosophisches Taschenwörterbuch: Catéchisme du Japonais – Katechismus des Japaners (Kommentare)
Über Geschmack kann man bekanntlich nicht streiten, besser: streiten schon, aber nicht entscheiden, denn er ist subjektiv und jede subjektive Vorliebe, so seltsam sie auch wäre, hat ihre Berechtigung. Der eine mag Kaviar, der andere verabscheut ihn.
Auch religiöse Vorlieben sind rein subjektiv, der eine verehrt Allah, der andere Jesus, der dritte Huizilopochtli. Versteckt hinter einem Streit um die beste Küche demonstriert Voltaire, wie absurd Streitigkeiten um die beste Religion sind und wie gefährlich es ist, wenn nur eine Religion das Sagen hat. Besser, es gibt zwölf davon und einen robusten Staat, der das Toleranzgebot auf seinem Territorium durchsetzt. Wenn man doch schon über den richtigen Geschmack nicht entscheiden kann, wie erst über die Frage nach dem richtigen Gott, den noch niemand sinnlich wahrgenommen hat.
Hintergrund:
A. England und Frankreich im 18. Jahrhundert:
England war nach dem Sturz nicht nur der katholischen Kirche (1534 d. Heinrich VIII und 1648 d. Cromwell), sondern auch aufgrund der Beschneidung der königlichen Macht durch ein starkes, aufstrebendes Bürgertum – der Vorgang ist unter dem Begriff der Glorious Revolution (1688/89) bekannt -, auf dem Weg zur führenden Weltmacht. Die Befreiung der Wissenschaft vor religiöser Bevormundung führte zu bedeutenden Entdeckungen und zur kräftigen Steigerung der Produktivität durch den daraus resultierenden technischen Fortschritt, siehe (Der Japaner), S. 141:
„…unsere Reichtümer nehmen zu, und wir haben zweihundert Liniendschunken, und sind der Schrecken unserer Nachbarn.“
Voltaire hatte die Vorzüge Englands während seines Exils 1726-1728 kennen- und schätzen gelernt. In seinen Philosophischen Briefen, die in Frankreich umgehend verboten wurden, berichtet er von den dortigen Entwicklungen. In Frankreich dagegen war die starke absolutistische Zentralmacht, weil sie von der katholischen Kirche unterstützt und vom Bürgertum verwaltet wurde, in der Lage, die alten, regional verstreuten Kräfte des Feudalismus niederzuhalten. Die schwankenden Kräfteverhältnisse zwischen den einzelnen Fraktionen bewirkte ein ständiges Auf- und Ab der religiösen und geistigen Unterdrückung im Land und führte dazu, dass Frankreich gegenüber England ins Hintertreffen geriet.
B. Veröffentlichungen im 18. Jahrhundert
– Voltaire, Lettres philosophiques von 1733, in denen er die gesellschaftlich intellektuelle Lage in England beschreibt.
– Voltaire, Essai sur les moeurs, Cramer: Genf, 1775. Im Kapitel 179 -182 behandelt Voltaire die Geschichte Englands seit Cromwell und bis Karl II.
– Rapin-Thoyras, Paul de (1661 – 1725), Jurist, Verfasser der ersten französischsprachigen Geschichte Englands, aus hugenottischer Familie. 1685, nach der Aufhebung des Edikts von Nantes, ging er ins engl. Exil. In seinem teils posthum erschienen Lebenswerk Histoire d’Angleterre, La Haye: de Rogissart, 1724 – 1735, 12 Bd., beschreibt er die unglaubliche Machtfülle der Katholika in England, die es ihr erlaubte, das Land buchstäblich auszusaugen. Das Werk wurde ins Deutsche (1758 – 1760) und ins Englische (1789) übersetzt.
Die folgenden Anmerkungen zu einzelnen Textstellen beziehen sich mit ihren Seitenangaben auf die von uns bei Reclam herausgegebene Ausgabe des Philosophischen Taschenwörterbuchs (2020):
Anmerkung 1: S. 137. Der Japaner: „Ganz und gar nicht, wir haben uns während nahezu zwei Jahrhunderten verfolgt..“). Das heißt, von Heinrich VIII 1534 bis 1688/9, der Glorious Revolution. Erst seitdem kehrte in England in religiösen Fragen relative Ruhe ein.
Anmerkung 2: (S.139 Der Japaner: „Die Quäker waren niemals von der Raserei besessen“). In Voltaires Philosophischen Briefen sind die ersten vier Kapitel den Quäkern gewidmet. Er lernte in London deren Religion kennen und verschaffte sich selbst ein Bild dieser nicht verfolgerischen Religionsgemeinschaft. Sie waren es, so lange sie selbst verfolgt wurden (1662 verboten, 1689 durch den Toleration Act wieder erlaubt) und blieben es sogar als dominante Religion in Pennsylvania.
Anmerkung 3: (S.140 Der Inder: „Es muss doch eine Küche geben, die die vorherrschende ist, nämlich die des Königs“). Voltaire stellt hier das Prinzip der englischen Staatskirche vor, der die Verfassung ein Ämterpatronat zugesteht, wenn sie sich nur für das vom Bürgertum erzwungene System der konstitutionellen Monarchie engagierte. Das war auch im 18. Jahrhundert noch ihre wichtigste Aufgabe, worin sie sich nicht von der katholischen Staatskirche in Frankreich unterschied, nur dass es sich dort um den Absolutismus handelte, aus dessen Vormundschaft sich das Bürgertum vor der Revolution noch nicht hatte befreien können.
Anmerkung 4: (S.142 Der Inder: „Japan, wo früher…“ ). Das Zitat von Louis Racine lautet im Original:
« L’Angelterre, ou jadis brilla tant de lumière/Recevant aujourd’hui toutes réligions/ N’est plus qu’un triste amas de folles visions » (Poème sur la Grace (1720). Er behauptet also, England würde keine intellektuellen Leistungen mehr hervorbringen, weil es jetzt so viele unterschiedliche Religionen dulde. Voltaire erklärt (der Japaner, ebd.), dass gerade weil es keine religiöse Unterdrückung gibt, die Wissenschaft in England floriert. Newton wäre ohne die größere religiöse Freiheit unmöglich gewesen und auch die technischen Erfindungen, die das Leben erleichtern und den Profit erhöhen, wie z.B. die Strumpfstrickmaschinen, wurden erst auf dem Boden der religiösen Toleranz möglich. Das ist nichts anderes als die Lehre Francis Bacons und John Lockes, nur umgekehrt: Meinen diese, da die Wissenschaft keine Autoritätsbeweise akzeptiert, sondern induktiv und empirisch vorgeht, dass die Kenntnisse über die Natur im Laufe der Zeit zu-, gleichzeitig aber religiöse Vorurteile und Aberglauben abnehmen, erklärt hier Voltaire, dass die Wissenschaft nur dort entsteht, wo die dogmatische geistige Alleinherrschaft der Kirche gebrochen wurde.
Philosophisches Taschenwörterbuch: Catéchisme du curé – Katechismus des Landpfarrers (Kommentare)
Fragt man heute in Polen, wo die katholische Kirche im Volk noch hohes Ansehen genießt und der Klerus nicht wie in Deutschland mit staatlich eingetriebenen Steuergeldern versorgt wird, einen Kleinbauern nach dem örtlichen Priester, hört man, dass er Landwirtschaft betreibe, für alle Feiern der Ansprechpartner sei und gute Arbeit leiste. Er wird als Mensch von eigenem Schlag betrachtet, nicht wie in Deutschland, als Beamter. Ein solcher Dorfpfarrer ist es, den Voltaire hier vorstellt und zwar nicht negativ; was er lehrt, ist vollkommen zweitrangig, denn auf sein Handeln kommt es an. Auf solche Pfarrer konnte auch die Französische Revolution setzen und ein solcher Pfarrer war auch der Abbé Meslier (1664 – 1729), ein Atheist, Seelsorger, Freund und Helfer seiner Gemeinde und Verfasser der ersten atheistischen Schrift (s. Das Testament des Abbé Meslier, Herausgegeben und eingeleitet von Günther Mensching, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1976).
Hintergrund:
A. Die Organisation der Kirche im 18. Jahrhundert:
Die Land- oder Dorfpfarrer (die Curés) bildeten mit den Vikaren die unterste Stufe der kirchlichen Hierarchie, über ihnen standen Bischofe, Erzbischöfe, Kardinäle. In Frankreich gab es 135 Bistümer und Erzbistümer, 34.658 Pfarreien mit ca. 60.000 Pfarrern/Vikaren. Hinzu kamen noch 60.000 Mönche und 71.000 Weltpriester. Sie machten 1,8% der Bevölkerung aus und besaßen 5-6% des Bodens, die ihnen jährlich 100 Millionen livres einbrachten, dazu kamen 123 Millionen livres aus der Kirchensteuer, dem Zehnten. Die höhere Geistlichkeit rekrutierte ihre Funktionsträger ausschließlich aus dem Adel und bestimmte alleine, wie die Einnahmen an die unteren Ränge weitergegeben wurden. Am wenigsten erhielten die Landpfarrer, am meisten die einflussreichsten Adligen mit den besten Pfründen (oft die großen Städte), eine Quelle dauernder Konflikte. Der Pfarrer war verantwortlich für die Taufen, Eheschließungen und Sterbefälle seiner Gemeinde. Er kontrollierte die öffentliche Erziehung und die Wohltätigkeitsmaßnahmen. Auch die Gemeindeversammlungen waren den Pfarrern unterstellt. Ein weitere wichtige Kontroll-Funktion waren die sogenannten Monitorien, mit dem die Kirche die Bevölkerung zur Beihilfe und Denunziation aufforderte, immer wenn ein Verbrechen begangen wurde.
B. „Der gute Pfarrer“ – Veröffentlichungen
– 1762 erschien Rousseaus Émile und dort im vierten Kapitel „La Profession de foi du vicaire savoyard“ (Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars), also eines Vertreters der untersten hierarchischen Stufe des französischen Klerus, eine entschieden antichristliche Schrift, in der Rousseau die Gleichrangigkeit aller Glaubensrichtungen einfordert. Voltaire veröffentlichte sie – trotz seiner Querelen mit Rousseau – auszugsweise in seinem Sammelband „Récueil nécessaire (Genf 1766)“.
[Le Recueil nécessaire, à Leipzig, 1765, in-8o, contient : 1° Avis de l’éditeur ; 2° Analyse de la religion chrétienne (sous le nom de Dumarsais) ; 3° le Vicaire savoyard, tiré de l’Émile de Rousseau ; 4° Catéchisme de l’Honnête Homme; 5° Sermon des Cinquante; 6° Examen important, par milord Bolingbroke (c’est-à-dire par Voltaire; 8° Dialogue du Douteur et de l’Adorateur; 8° Les dernières paroles d’Épictète à son fils; 9° Idées de La Mothe Le Voyer]
– Voltaire bezieht sich außerdem auf den Abbé de Saint Pierre (1658-1743) und seine Abhandlung Observations politiques sur le célibat des prètres.
– Auch in der Enzyklopädie erschien ein Artikel „Célibat“ der den Argumenten des Abbé de Saint Pierre im wesentlichen folgt.
Lit: Sage, Pierre, Le ‚bon prêtre‘ dans la littérature française d’Adamis de Gaule au Génie due Christianisme, Genève 1951
Die folgenden Anmerkungen zu einzelnen Textstellen beziehen sich mit ihren Seitenangaben auf die von uns bei Reclam herausgegebene Ausgabe des Philosophischen Taschenwörterbuchs (2020):
Anmerkung 1: S. 144, 2. Ariston: „Verdrießt es sie nicht, keine Frau zu haben?“): Die Aufklärer waren allgemein gegen das Zölibat. Die Forderung nach Abschaffung des Zölibats verfolgte das Ziel einer Schwächung der katholischen Kirche durch Verweltlichung. Nicht nur verhindert das Zölibat das Abfließen von Lebensenergie des kirchlichen Personals in weltliche Dinge, sondern sichert der Kirche auch durch die Erbschaften ihrer ehe- und kinderlosen Priester bedeutende Einkommenszuwächse. Da Voltaire für sich selbst eine Verheiratung nie in Betracht zog, könnte es sein, dass diese Verweltlichung sein eigentliches Ziel war. Vielleicht konnte er so auch einige der Volkspriester auf die Seite der Aufklärung ziehen. In dem Artikel Catéchisme Chinois – Chinesischer Katechismus führt er, ebenfalls mit Bezug auf den Abbé de Saint-Pierre, noch die Nützlichkeit, die von den vielen Kindern solcher Priesterehen ausgehen würde, an (s. 5. Gespräch, S. 128/9).
Anmerkung 2 (S.145 Theotimus: „Die Beichte ist eine großartige Sache“): In der Ausgabe des Philosophischen Taschenwörterbuchs von 1765 nahm Voltaire einen kurzen Artikel zur Beichte auf, in dem er es anders sieht. Er weist darauf hin, dass die Beichte zunächst als ein Mittel der Kontrolle und Überwachung in der Kirche selbst eingeführt wurde. Erst später wurde sie allgemein. Weil sich durch die Beichte jeder Verbrecher Erleichterung verschafft, trägt sie eher zu deren Vermehrung als zur Vermeidung bei. Nur kleine Diebe kann man durch die Beichte etwa zur Rückgabe des Gestohlenen bewegen.
Anmerkung 3: (S.146 Theotimus: „Es gibt Rituale, bei denen die Heuschrecken, die Zauberer und die Schauspieler exkommuniziert werden“.)
– Heuschrecken:
Die Anmerkung in dem Kommentar der Voltaire-Foundation zu diesem Punkt bemerkt, dass Heuschrecken keiner Exkommunikation unterzogen wurden. Man hat stattdessen in einem speziellen Ritual den Ackerboden geweiht, um ihn vor den Heuschrecken zu schützen.
– Zauberer:
Papst Paul V. führte 1614 die Exkommunikationsrituale gegen Zauberer und Hexer ein, die dann in den Inquisitionsverfahren zur Anwendung kamen.
– Schauspieler:
-> Synode von Elvira (306): „Wenn ein Zirkuswettfahrer oder ein Pantomime zum Glauben übertreten will, muss er vorher seinem Gewerbe entsagen und darf nachher nicht mehr zu ihm zurückkehren; tut er es doch, soll er aus der Kirche ausgestoßen werden.“
-> Im Jahre 314 erklärte das Konzil von Arles die Schauspieler für exkommuniziert.
-> Das Konzil von Aachen 816 verbietet Klerikern die Teilnahme an Schauspielen.
-> Auf der Synode von Cambrai wurde 1300 bestimmt: „Kein Christ darf von der Kommunion zurückgewiesen werden, außer wer exkommuniziert ist oder wer durch notorisches Verbrechen gebrandmarkt ist, wie die öffentlichen Dirnen, die Komödianten und Spielleute.“
-> 1649 verordnete die Rituale von Châlon als Erste, dass Schauspieler nicht zur Kommunion zugelassen sind. Bis 1713 sollte, wie Jean Dubu aufzeigt (Les églises chrétiennes et le théâtre (1550-1850), Grenoble 1997), diese Intoleranz zunehmen. Nicht nur die Kommunion, sondern auch das Recht auf Bürgschaft und das Begräbnis wurde den Schauspielern verweigert. Die o. g. Angaben stammen aus Manuel Stadler Die Exkommunikation des Schauspielers zwischen dem Ende des Römischen Reiches bis ins 19. Jhdt.
Voltaire hatte selbst bittere Erfahrung mit dieser Variante der kirchlichen Misanthropie gemacht, als man seiner engen Freundin, der Pariser Schauspielerin Adrienne Lecouvreur das Begräbnis verweigerte (siehe dazu sein bewegendes Gedicht).
Anmerkung 4 (S.147 Ariston: „Was werden Sie tun, um die Bauern daran zu hindern, sich an Fest- und Feiertagen zu betrinken?“): Die Anmerkung der Voltaire Foundation weist darauf hin, dass Voltaire die Berechnung des Abbé de Saint Pierre übernommen hat. Voltaire kam immer wieder auf dieses Thema zurück.
Was zunächst wie ein Versuch zur Beschneidung der freien Tage der armen Landbevölkerung aussieht (Voltaire war schließlich in Ferney ein Großgrundbesitzer mit bis zu 1500 „Untertanen“), versteht sich etwas anders, wenn man folgendes bedenkt:
– Die Anzahl der Feiertage variierte von Diözese zu Diözese, jeder Bischof versuchte die Loyalität seiner Gemeindemitglieder durch spezielle Feiertage (Heilige, spez. Anlässe) zu heben, was deshalb erfolgversprechend war, weil an solchen Tagen die religiöse Indoktrination mit großem Elan praktiziert wurde. Ende des 13. Jahrhunderts ist von ca. 40 – 60 Feiertagen pro Jahr auszugehen.
– Erste Kritik an den vielen Festen kam im 15. Jahrhundert von humanistischer Seite (Nicolas de Clamange, Contre l’institution des fêstes nouvelles (1413), auch bereits mit dem Argument, dass die Bauern, könnten sie arbeiten, sehr viel besser leben würden. Dies war der ökonomische Blick des Stadtbürgertums, das in harter Arbeit zu Wohlstand und Unabhängigkeit gekommen war. (siehe: L’évolution du nombre de jours chômés à la fin du Moyen Âge : enjeux spirituels et économiques, 2007).
In einem anderen Artikel (Temps de travail et fêtes religieuses au XVIIIe siècle, Jean-Yves Grenier, in: Revue historique 2012/3, n° 663, S. 609 – 641) erklärt der Autor, dass sich die Anzahl der Feiertage im Verlauf des 18. Jahrhunderts in Frankreich nahezu halbiert habe. Offenbar hatten sich die Manufakturbesitzer, Handwerker und Landbesitzer , die an der erhöhten Arbeitszeit interessiert waren, gegen die Kirche durchgesetzt.
Außer dass sie die Menschen dem kirchlichen Einfluss aussetzten, behinderten die vielen Feiertage auch sonst die ökonomischen Abläufe. So wurden zum Beispiel Transporte, ohnehin beschwerlich und langsam, plötzlich angehalten, weil in einer Region ein kirchlicher Feiertag ausgerufen worden war. Damit war die Belieferung von verderblichen Waren auf die Märkte der Städte oft schwierig, wenn nicht unmöglich.
Voltaire, richtig verstanden, argumentiert folglich gegen die Kirche,wenn er erklärt, dass weniger Feiertage den Bauern und Handwerkern ein höheres Einkommen, eine bessere Gesundheit, niedrigere Ausgaben für Alkohol bringen. Diese vertrat zu dieser Frage verständlicherweise genau das Gegenteil.
Rezension: Voltaire, Der unwissende Philosoph, aus dem Französischen von Ulrich Bossier, Nachwort von Tobias Roth, Ditzingen: Philipp Reclam Jun. (RUB 14169), 2022, 108 S.
Die unterdessen fünfte Übersetzung des Philosophe Ignorant ist eine sprachliche Aktualisierung dieser philosophischen Standortbestimmung Voltaires aus dem Jahre 1766. Wie jede Neuübersetzung krankt sie teilweise am Zwang, eine Verbesserung liefern zu müssen, ohne wirklich eine solche zu sein und ist allerdings teilweise wirklich besser als die zuletzt erschienenen.
Die Anmerkungen gehen kaum über die bereits bekannten aus den französischen Gesamtausgaben von Moland und der Voltaire Foundation hinaus, insgesamt ist die Übersetzung und sind die Anmerkungen solide.
Anders das Nachwort von Tobias Roth. Schon der erste Satz („Jemand wie Voltaire kann uns nicht weismachen, er wisse nichts“) zeigt, dass er nicht versteht, worum es Voltaire in diesem Werk ging und gehen musste. Er fokussiert auf die Skepsis, die Voltaire ganz offensichtlich als Grundhaltung in dieser Abhandlung ins Werk setzt, lässt aber die existentielle Bedrohung, die für Voltaire aus den Terrorurteilen Sirven/de La Barre in den Jahren 1765 1766 entstand, völlig außer Acht, obwohl sie im Hintergrund der Argumentation nur allzu offensichtlich die Regie bestimmt1.
Voltaires „Wir müssen wieder bei Null anfangen“ ist nichts anderes, als eine Selbstvergewisserung angesichts dieser großen Verunsicherung in den aufgeklärten Kreisen der Jahre 1765/1766.
Wir haben dies ausführlicher in unserer Inhaltsangabe zum Unwissenden Philosophen dargestellt und wollen den Punkt deshalb hier nicht weiter ausführen.
Seltsam auch, wie Roth Voltaire zu einem Ethiker macht, dem es im Unwissenden Philosophen um eine Art Theorie der Nützlichkeit und der Gerechtigkeit ginge. In der Tat beschäftigt sich Voltaire ab Kapitel XXX mit der Moral, jedoch tut er dies in vor allem praktischer Absicht, um nämlich aus einer moralisch unanfechtbaren Position seine Gegner um so besser angreifen zu können und um wiederum seinen Anhängern zu zeigen, dass es nicht anders geht: Man muss den Kampf der Aufklärung bis zum Ende weiterführen!
Schon einmal war uns Tobias Roth negativ aufgefallen, als er sich an der Vernebelung der Tragödie Mahomet oder der Fanatismus beteiligte. Indem er in seinem Nachwort die inquisitorischen Aktivitäten im Hintergrund des Unwissenden Philosophen verschweigt, hat Tobias Roth ein zweites Beispiel dafür geliefert, dass er unter dem Einfluss antiaufklärerischer Vernebeler steht.
Man sollte ihn kein weiteres Nachwort zu einem Werk Voltaires schreiben lassen, es sei denn, das Vernebeln würde bezweckt.
- Nähere Angaben zur irritierten Aufnahme des Unwissenen Philosophen im Umfeld Voltaires (z.B. v. Grimm): René Pomeau, Voltaire en son temps II, p. 199 – 203 ↩︎
Le philosophe ignorant – Der unwissende Philosoph (1766)
Die erste Ausgabe des Philosophe ignorant erschien anonym im Jahr 1766. Voltaire beschäftigte sich nachweislich bereits im Winter 1765 mit dem Werk, es wurde im Jahr 1767 sechsmal nachgedruckt.
ZUM INHALT: Zweieinhalb Kotaus vor und einen halben zurück!
Im 18. Jahrhundert war die Macht der kirchlichen Ideologie bei weitem noch nicht gebrochen. Für die Aufklärung ging es darum, den Zeitgenossen die Augenbinden zu lösen, um sie die Realität klar sehen zu lassen. Das hieß, die christliche Religion aus den Köpfen zu vertreiben, um anschließend wieder bei Null aufzusetzen, was wiederum bedeutete, an allem zu zweifeln, was 1700 Jahre von dieser Geißel der Menschheit in die Köpfe gestopft worden war. Soweit zumindest war Voltaire 1764 bis zu seinem Philosophischen Wörterbuch vorangekommen. Dann aber wurde 1765 das Terrorurteil gegen die Familie Sirven ausgesprochen.
Voltaire-Übersetzer: Christlob Mylius
Christlob Mylius, (* 11.11.1722 in Reichenbach an der Pulsniz – † 6.3.1754 in London). Sein Vater war der Pfarrer Caspar Mylius, seine Mutter dessen zweite Ehefrau Marie Elisabeth geb. Ehrenhaus. Er hatte vier ältere Brüder, die alle den Christus im Namen tragen: Christlieb, Christfried, Christhelf und Christhilf.
Von ihm stammt die bisher einzige Übersetzung von Voltaires Streitschrift, der Diatribe du Docteur Akakia, 1752/3.
Nach seinem Studium in Leipzig entwickelte er sich, vielseitig interessiert und begabt, zu einem der ersten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Er gab mehrere Periodika heraus, unter anderem die Zeitschrift „Der Wahrsager“, die 1749 von der preußischen Zensur nach der 20. Ausgabe (im Mai) verboten wurde (so viel zu Friedrichs Haltung zur Pressefreiheit, die er Mai 1749 dann auch entschieden einschränkte). Dazu heißt es bei Ernst Cosentius, dem bis heute besten Bericht zu Mylius Leben:
„Voltaire-Übersetzer: Christlob Mylius“ weiterlesenGewissermaßen als Feuilleton zur Zeitung gab M. seit dem 2. Januar 1749 unter dem Titel: „Der Wahrsager“ wiederum eine satirisch-moralische Wochenschrift heraus, die lediglich als eine Erwerbsquelle von M. zu nennen wäre, hätten sich die Schullehrer Berlins nicht über das 7. Stück des „Wahrsagers“, in dem sie sich gezeichnet glaubten, beschwert. Dies Stück darf man eine ironische Empfehlung der La Mettrie’schen Philosophie nennen. Es gab, wie das 9. Stück, das ein satirisches Lob der Hahnreihe brachte, den Ministern Friedrich’s des Großen Anlaß, beim Könige ein neues Censur-Edict zu beantragen und den Verfasser und Verleger des „Wahrsagers“ zu verwarnen. Daß die Leser satirischer Blätter stets nach lebenden Modellen suchten, war ein alter Uebelstand. Nach Mylius’ Ankündigung zum „Wahrsager“ hatten sie vielleicht auch ein Recht dazu. Jetzt, wo M. gewarnt war, lenkte er sein Blatt in die ruhige Bahn einer wohlgesitteten Wochenschrift und wurde nicht müde zu versichern, daß er Niemanden im Bösen meine; aber Friedrich der Große verbot trotzdem den „Wahrsager“ und erließ am 11. Mai 1749 das von den Ministern vorgeschlagene Censur-Edict. Das letzte (20.) Stück des „Wahrsager“ datirt vom 15. Mai 1749.
Volker Reinhardt, Voltaire, eine Biographie, Rezension (7): Der Patriarch von Ferney 1759-1766 und Voltaires Tod (8) am 30.5.1778
Es gibt 26 Voltaire-Biographien in deutscher Sprache, die meisten erzählen die Ereignisse seines Lebens, einige integrieren die Geschichte seines schriftstellerischen Schaffens – die bisher gelungenste, die von Theodore Besterman (1969), findet das Wohlwollen von Reinhardt nicht, weil sie zu sehr auf Seite Voltaires steht.
Wie dem auch sei, eine zusätzliche Voltaire-Biographie sollte, da sein Leben genau in den Zeitabschnitt fällt, der das Ende der jahrhundertelangen Adelsherrschaft durch die Französische Revolution vorbereitet, diese Ereignisse systematisch einbinden, oder sie wird zwangsläufig epigonal. Epigonal ist der Begriff, der am ehesten auf Reinhardts Arbeit zutrifft. In weiten Teilen ist sie nur eine gekürzte Wiedergabe der nicht auf Deutsch erschienenen Voltaire-Biographie von Réné Pomeau, erweitert um ausufernde Inhaltsangaben vieler einzelner Werke.
Wie soll man Voltaires zentrale Forderungen verstehen: Wissenschaftlichkeit statt Glauben, Beobachten statt Autoritätsbeweis, Anerkennung durch Verdienst anstelle von Herkunft, sowie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, wenn man ihn nicht als den Vertreter der aufstrebenden, jedoch vom Absolutismus noch abhängigen bürgerlichen Klasse begreift? Wie seinen Kampf gegen die katholische Kirche einordnen, wenn man diese nicht als Stütze der absolutistischen Aristokratie auffasst, zwar ebenfalls abhängig vom Königshaus, aber als eigenständige Kraft mit gehässig-tödlicher Eigendynamik handelnd? Die Kräfteverhältnisse sind gewiss nicht immer einfach zu verstehen; Jansenismus, Hugenotten, Feudaladel kommen mit ihren eigenen Interessen und Kämpfen hinzu. Das alles zu integrieren, ist möglicherweise eine Aufgabe, die ein Einzelner kaum bewältigen kann. Reinhardt wäre es zuzutrauen gewesen, sein Schaffenshorizont ist, wie seine Publikationen zeigen, weit genug. Aus irgendeinem Grunde verfasste er stattdessen ein Kompendium der Inhaltsangaben von zahlreichen Werken Voltaires, ergänzt durch biographische Informationen und einigen wenigen, isoliert dastehenden kulturhistorischen Erläuterungen.
„Die freundliche Ideologie“, Stefan Ripplinger, Junge Welt, 29.7.2023
In der Wochendausgabe der Jungen Welt vom 29.7.23, die unter dem grotesken, aber ernstgemeinten Titel „Kapitalismus killt Klima“ aufmachte, erschien auch der oben genannte Artikel eines gewissen Stefan Ripplinger, ein Vielschreiber, der auch die obskure Jungle World mit „auf den Weg“ brachte. In seinem neuesten Elaborat verspricht er, drei Publikationen vorzustellen, die den modernen „Wokismus“ kritisieren. Wir werden es hier unterlassen, seine äußerst fragwürdige Kritik einer Analyse zu unterziehen, das lohnte den Aufwand nicht und jeder Leser kann sich ja selbst ein Bild davon machen. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die in dem Artikel enthaltene Abwertung der Aufklärung, die er, wie auch den Wokismus, als „freundliche Ideologie“ tituliert und insbesondere auf seine Schmähung Voltaires, ihres wichtigsten und bekanntesten Vertreters.
„„Die freundliche Ideologie“, Stefan Ripplinger, Junge Welt, 29.7.2023“ weiterlesen