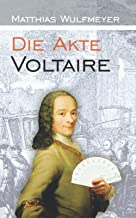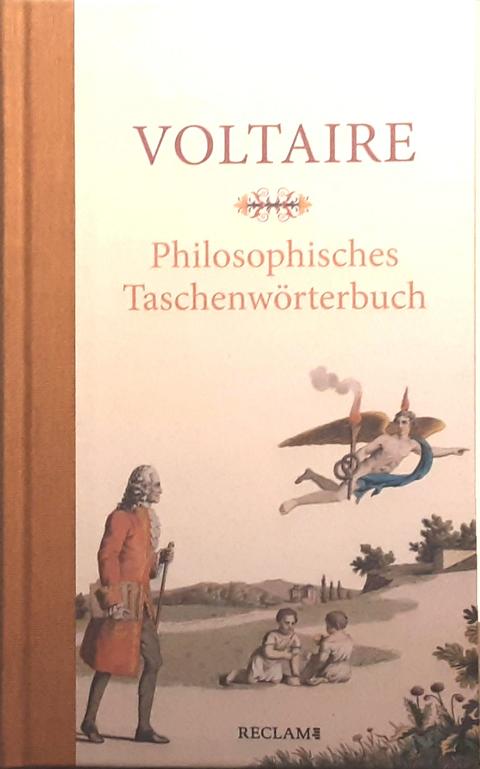Wer, wenn nicht Dieter Meier, wäre besser geeignet, einen neuen Standard für zukünftige Candide Übersetzungen zu setzen? Dieter Meier war langjähriger Lektor für französische Literatur im Reclam-Verlag. Er betreute die Neuübersetzung von Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit und auch unser Projekt, die Herausgabe der ersten vollständigen Übersetzung des Philosophischen Taschenwörterbuchs von Voltaire, – um nur diese beiden zu nennen.
Im Mai 2025 erschien nun in der Reclam Universalbibliothek der von ihm übersetzte Candide, versehen mit ausführlichen und wertvollen Anmerkungen zum Verständnis dieses Klassikers der Weltliteratur. Um es vorwegzunehmen: An seiner Übersetzung gibt es nichts auszusetzen: Sie folgt dem Ursprungstext, sie enthält keine Fehler und auch keine nach Originalität heischenden Wortschöpfungen wie etwa die zuletzt (2018) erschienene Übersetzung von Tobias Roth (siehe dazu unsere ausführliche Rezension). Seltsam nur, dass ausgerechnet Tobias Roth das Nachwort zu dem Büchlein verfasste – der Verlag wird wissen, aus welchen Gründen, doch dazu später.
Eine Rezension von Rainer Bauer“ weiterlesen