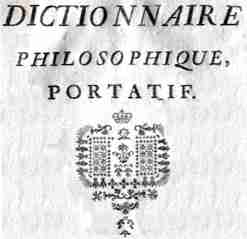Dieser Kommentar gibt Hintergrundinformationen zu dem Artikel Destin aus dem Philosophischen Wörterbuch (1764) von Voltaire, das wir 2020 erstmals vollständig ins Deutsche übersetzt und im reclam Verlag herausgegeben haben. Das Buch gibt es gebunden und seit 2023 auch als Taschenbuch. Die Übersetzung des Artikels Critique besorgte Angelika Oppenheimer; es ist die erste Übersetzung ins Deutsche.
A. Hintergrund
Wenn wir heute von Schicksal sprechen, meinen wir etwas Unabänderliches oder Zufälliges, worauf wir keinen Einfluss haben, das aber unser Leben stark bestimmt. Wir akzeptieren, dass das Schicksal eines Menschen durch den Zufall der Geburt (das Geschlecht, in welche Familie man hineingeboren wird), durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, oder aber durch Einflüsse der Natur (z.B. Krankheiten oder Naturkatastrophen) bestimmt wird.
Auf der anderen Seite sehen wir die Freiheit des Einzelnen in der Möglichkeit liegen, sich für oder gegen das schicksalhaft Vorbestimmte zu stemmen (zum Beispiel kann sich ein junger Mensch mit großer Energie und Ehrgeiz aus einfachen Verhältnissen herausarbeiten). Mehr noch, es erscheint heute sogar verwerflich, wenn sich einer in sein Los, sei es durch Herkunft, sei es durch Krankheit beschwert, widerstandslos ergibt. Hinter diesem Vorwurf verbirgt sich die Behauptung, dass die soziale Herkunft nicht so entscheidend sei, als dass der Einzelne nicht für seine Entwicklung selbst verantwortlich wäre: Jeder ist seines Glückes Schmied…
Dem bereitet eine Ideologie das Terrain, die marktschreierisch Biographien erfolgreicher Einzelner so weit in den Vordergrund schiebt (Fußballstars, Schauspieler, Musiker…), dass mit der ungleichen Chancenverteilung und deren Folgen kein Unrechtsempfinden mehr verbunden ist. Fast so wie im 18. Jahrhundert, in dem an den Privilegien der Adelsgesellschaft der „gemeine Mann“ nicht einmal im Schlaf zweifeln durfte.
B. Die Diskussion über das Schicksal im 18. Jahrhundert
Jede Debatte über das Schicksal hängt logischerweise mit der über den freien Willen zusammen: Wenn alles schicksalhaft bestimmt ist, bleibt vom freien Willen nichts mehr übrig und umgekehrt. Dem entsprechend kann man die Debatte um das Schicksal im 18. Jahrhundert als eine Entwicklung darstellen, die das menschliche Los von „gottgelenkt“ zu „eigenverantwortlich“ hinführt:
Wer, wie das fundamentalistische Christentum (Jansenisten und Calvinisten) an ein vom allmächtigen Gott gelenktes Schicksal glaubt, kann dem Einzelnen keine eigenen Willensentscheidungen einräumen – allenfalls kann er sich mit Gottes Gnade aus der Erbsünde befreien und auf zukünftige Erlösung hoffen.
Wenn dann Baruch Spinoza (1632-1677) Gott in der Natur aufgehen lässt, was ihm den Vorwurf des Atheismus eintrug, ändert dies an der Bedeutung des Schicksals zunächst einmal nicht viel: an die Stelle der göttlichen Allmacht tritt die der Natur und der Naturgesetze. Ähnlich bei Thomas Hobbes (1588-1679): Weil man bei jeder Entscheidung herausfinden kann, weshalb ein Mensch so und nicht anders gehandelt hat, argumentiert er, dass der Mensch nicht frei, sondern unter dem Einfluss seiner inneren Wünsche und Triebe handle.
John Locke (1632-1704), der wie Spinoza und Hobbes die christliche Prädestinationslehre (also dass alles vorherbestimmt ist) ablehnt, räumt dem Menschen im Unterschied zu diesen einen menschlichen freien Willen ein, der ihn in die Lage versetzt, sich zwischen verschiedenen Alternativen nach vernünftigen Kriterien zu entscheiden. Erstmals wird der Mensch nicht als Getriebener, nicht mehr als willenloses Instrument einer höheren Macht vorgestellt.
Sobald aber Gott vollständig hinter die Natur zurücktritt und in das Weltgeschehen nicht mehr eingreift, sich also, nachdem er die Welt erschaffen hat, in den wohlverdienten Ruhestand zurückzieht, ist die Vorstellung von der Allmacht des Schicksals nicht mehr zu halten. Zwar versuchen Alexander Pope (1688-1744) und Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) einen Rettungsanker zu konstruieren, indem sie dem von Gott erschaffenen Werk bescheinigen, es sei „die beste aller möglichen Welten“ und damit sämtlichen Schandtaten, Kriegen, Krankheiten und Verbrechen einen Freibrief erteilen (man weiß ja nie, wozu es gut ist…), dem Zweifel an der göttlichen Allmacht war damit aber nicht mehr beizukommen. Leibniz versuchte durch seine haarspalterische Unterscheidung zwischen Bestimmtheit und Notwendigkeit einerseits, Unbestimmtheit und Freiheit andrerseits, die Vorstellung von einem allmächtigen Gott zu retten . Die Sünde Adams war vorherbestimmt, aber nicht notwendig, sein Handeln war frei, aber nicht bedingungslos-unbestimmt. Und schließlich seien gerade die Strafen und Belohnungen dazu geschaffen, „den Willen ein anderes Mal zu einem besseren Handeln zu bestimmen“. (Theodizee, 369).
Auch wenn Leibniz von Pope insofern abweicht, als es bei ihm in der bestmöglichen Welt dem Menschen unverständliche, seltsame Zufälle und Übel gibt, konnten seine Anhänger mit der Behauptung, dass wir in der besten aller möglichen Welten lebten, die ein allmächtiger Gott geschaffen habe, nicht mehr überzeugen:
Als im Jahr 1755 in Lissabon 30.000 Menschen einem verheerenden Erdbeben zum Opfer fielen, kamen sie in ziemliche Erklärungsnot: Wie kann ein allmächtiger Gott gewollt haben, dass so viele unschuldige Menschen unter den Trümmern ihrer Häuser umkommen?
Die Zweifel nahmen eher noch zu.
Voltaire verkörpert diese Zweifel wie kein anderer. Er akzeptiert die Unabänderlichkeit wirkender Naturgesetze, insofern ist der menschliche Wille nicht vollkommen frei. Freiheit ist aber das Vermögen, unter verschiedenen Handlungsalternativen eine bewusste, vernunftgemäße Entscheidung darüber zu treffen, was man tun will (s. dazu auch den Artikel De la Liberté – Von der Freiheit). In einem Brief an den 26 jährigen Kronprinzen und späteren preußischen König Friedrich II (der im Übrigen zum Ärger seines Vater von der Macht des Schicksal überzeugt war) leitet er seinen Freiheitsbegriff her. Wir fügen den gesamten Abschnitt, neu übersetzt, im Quellenverzeichnis ein, weil er exemplarisch die Argumente der Aufklärung gegen die verbleibende Gottesfürchtigkeit zusammenfasst.
Über Voltaire weit hinaus gehen Rousseau und Helvétius: Sie sehen die Einschränkungen durch das Schicksal (durch Geburt, durch Erziehung) als gesellschaftlich bedingt, d.h. als relativ und prinzipiell durch Menschen veränderbar an und halten an der Existenz eines freien Willens des Einzelnen fest. Der Mensch kann sich den gesellschaftlich bedingten Einschränkungen in freier Willensentscheidung widersetzen und somit sein Schicksal, wenn nicht selbst gestalten, so doch wenigstens beeinflussen. Sie betonen die Bedeutung der Erziehung und hoffen darauf, dass eine breite Schicht von besser gebildeten und erzogenen Menschen auch die Gesellschaft gerechter mache, hofften also auf eine Veränderung von unten, während Voltaire – vergebens – noch auf die aufgeklärten Fürsten setzte.
C. Quellen
– Bayle, Pierre, Réponse aux questions d’un provincial, Rotterdam: Reinier Leers 1704 6 Bd
– Pluquet, François André Adrien, Examen du fatalisme: ou Exposition & réfutation des différens systêmes de fatalisme qui ont partagé les philosophes sur l’origine du monde, sur la nature de l’âme et sur le principe des actions humaines, Paris, Didot & Barrois, 1757, 3 vol.
[Pluquet (1716 – 1790) vertitt die Anschauung, dass das Böse – wie Naturkatastrophen – einen positiven Effekt auf die Menschen haben kann. Sie gegen Gott zu positionieren, sei somit grundverkehrt.]
Dieses Buch gibt einen Überblick über über die Einführung des Fatalismus bei den ältesten Völkern, in Ägypten, Chaldäa, Indien und den anderen Ländern des Orients und verfolgt seinen Fortschritt in den verschiedenen Schulen Griechenlands bis zum Ursprung des Christentums und von dieser Zeit an bis zum Untergang des Niederen Reiches.
Pluquet erläutert die wichtigsten fatalistischen Gruppierungen unter den Christen des Ostens und des Westens, den Einfluss des Judentums. Er zeigt, wie die Denksysteme von Aristoteles, Pythagoras, Platon, Zenon, Anaximander, Diogenes von Apollonia und Epikur mit der Auswanderung der griechischen Gelehrten nach Italien neue Schulen des Fatalismus hervorbrachten. Er verfolgt die Einführung der Vernunft in die Wissenschaften durch Francis Bacon, der die Vorurteile untergrub, indem er das Denken befreite, damit es durch methodischen Zweifel zur Wahrheit gelangen konnte, eine Methodik, die, so Pluquet, alsbald von Hobbes und Spinoza aufgegriffen und missbraucht worden sei, um den Fatalismus in neuen Formen wieder einzuführen. Die Systeme von Toland, Collins, La Mettrie und einigen anderen weniger bekannten Schriftstellern werden vom Autor ebenfalls dargelegt und – natürlich – bekämpft.
Pluquet schrieb auch ein dreibändiges Ketzerlexikon, zwar ist das ein anderes Thema, aber zu seiner Charakteristik lese man aus diesem Buch den auf deutsch übersetzten Artikel über Luther (Tenor: Alles war ruhig und friedlich – bis dieser Luther kam).
– Leibniz, Gottfried Wilhelm, Die Theodizee von der Güte Gottes, der Freiheit des Menschen und dem Ursprung des Übels, Darmstadt: Wiss. Buchges., 1985
–Voltaire, Zadig ou la déstinée, histoire orientale 1748, [dt. erstmals 1748: Zadig, eine gantz neue morgenländische Geschichte, Göttingen: Vandenhöck 1748],
– Voltaire, Brief an Friedrich II vom 23.1.1738 (D1432), hier der erwähnte Auszug, in dem er die Beziehung zwischen Schicksal und freiem Willen erklärt:
„Zunächst einmal stelle ich fest, dass Eure Königliche Hoheit die Auffassung von Leibniz und Wolff vom zureichenden Grund teilt. Das ist eine sehr schöne Idee, das heißt, eine sehr wahre Idee: Denn schließlich gibt es nichts, das keine Ursache hat, nichts, das keinen Grund für seine Existenz hätte. Schließt diese Idee die Freiheit des Menschen aus?
1. Was verstehe ich unter Freiheit? Die Fähigkeit zu denken und entsprechend zu handeln; eine sehr begrenzte Fähigkeit, wie alle meine Fähigkeiten.
2. Bin ich es, der denkt und handelt? Ist es ein anderer, der all das für mich tut? Wenn ich es bin, bin ich frei: Denn frei zu sein bedeutet zu handeln. Was passiv ist, ist nicht frei. Handelt ein anderer für mich? Dann werde ich von diesem anderen getäuscht, wenn ich glaube, selbst zu handeln.
3. Wer ist dieser andere, der mich täuschen möchte? Entweder gibt es einen Gott oder nicht. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er es, der mich ständig täuscht. Er ist das unendlich weise, unendlich konsequente Wesen, das sich ohne zureichenden Grund ewig mit Irrtümern beschäftigt, die seinem Wesen, das die Wahrheit ist, direkt entgegenstehen.
Wenn es keinen Gott gibt, wer täuscht mich dann? Ist es die Materie, die von sich aus keine Intelligenz hat?
4. Um uns trotz unseres inneren Gefühls, trotz dieses Zeugnisses unserer Freiheit, zu beweisen, dass diese Freiheit nicht existiert, muss man notwendigerweise beweisen, dass sie unmöglich ist. Das scheint mir unbestreitbar. Sehen wir uns an, warum sie unmöglich sein könnte.
5. Diese Freiheit kann nur auf zwei Arten unmöglich sein: entweder weil es kein Wesen gibt, das sie geben kann, oder weil sie in sich selbst ein Widerspruch ist, so wie ein Quadrat, das länger als breit ist, ein Widerspruch ist. Da aber die Idee der Freiheit des Menschen an sich nichts Widersprüchliches enthält, bleibt zu prüfen, ob das unendliche und schöpferische Wesen frei ist und ob es, wenn es frei ist, einen Teil seiner Eigenschaft dem Menschen geben kann, so wie es ihm einen kleinen Teil seiner Intelligenz gegeben hat.
6. Wenn Gott nicht frei ist, ist er kein Handelnder: also ist er nicht Gott. Ist er jedoch frei und allmächtig, folgt daraus, dass er dem Menschen die Freiheit geben kann. Es bleibt also die Frage, welchen Grund man hätte zu glauben, dass er uns dieses Geschenk nicht gemacht hat.
7. Es wird behauptet, dass Gott uns keine Freiheit gegeben hat, weil wir, wenn wir handelnde Wesen wären, in dieser Hinsicht unabhängig von ihm wären: Und was würde Gott tun, sagt man, während wir eigenständig handelten? Darauf antworte ich zweierlei: 1. Was Gott tut, wenn die Menschen handeln, ist das, was er tat, bevor sie waren, und was er tun wird, wenn sie nicht mehr sind; 2. Seine Macht ist für die Erhaltung seiner Werke notwendig und diese kleine Freiheit, die er uns gewährt, schadet seiner Allmacht keinesfalls, da sie selbst eine Wirkung seiner unendlichen Macht ist.
8. Es wird eingewandt, dass wir uns manchmal gegen unseren Willen zu etwas hinreißen lassen, und ich antworte: Also sind wir manchmal auch Herr über uns selbst. Krankheit beweist, dass es Gesundheit gibt, und Freiheit ist die Gesundheit der Seele.
9. Man fügt hinzu, dass die Zustimmung unseres Geistes notwendig ist und dass der Wille dieser Zustimmung folgt: folglich will und handelt man notwendigerweise. Ich antworte, dass man in der Tat notwendigerweise begehrt; aber Begehren und Wille sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, und zwar so unterschiedlich, dass ein weiser Mensch oft will und tut, was er nicht begehrt. Seine Begierden zu bekämpfen ist die schönste Wirkung der Freiheit, und ich glaube, dass eine der großen Ursachen für das Missverständnis, das zwischen den Menschen in dieser Frage besteht, darin liegt, dass man oft den Willen und das Begehren verwechselt.
10. Es wird eingewandt, dass es keinen Gott gäbe, wenn wir frei wären; ich glaube hingegen, dass wir gerade deshalb frei sind, weil es einen Gott gibt. Denn wenn alles notwendig wäre, wenn diese Welt aus sich selbst heraus existierte, aus einer absoluten Notwendigkeit heraus (was voller Widersprüche ist), dann wäre es sicher, dass in diesem Fall alles durch notwendigerweise miteinander verbundene Abläufe geschehen würde: Es gäbe also keine Freiheit; ohne Gott gäbe es also keine Freiheit. Ich bin sehr überrascht, dass die Überlegungen zu diesem Thema dem berühmten Herrn Leibniz entgangen sind.
11. Das übelste Argument, das jemals gegen unsere Freiheit vorgebracht wurde, besagt, dass sie mit der göttlichen Vorsehung unvereinbar sei. Und wenn man mir sagt: Gott weiß, was Sie in zwanzig Jahren tun werden, also ist das, was Sie in zwanzig Jahren tun werden, absolut notwendig, dann gebe ich zu, dass ich am Ende bin, dass ich nichts zu antworten habe und dass alle Philosophen, die zufällige Ereignisse in der Zukunft mit der Vorhersehung Gottes in Einklang bringen wollten, sehr schlechte Gesprächspartner waren. Es gibt genug Determiniertes, um zuzugestehen, dass Gott künftige Zufälligkeiten sehr wohl ignorieren kann, ungefähr so, wie auch ein König, wenn ich so sagen darf, nicht wissen kann, was ein General tun wird, dem er alle Vollmachten gegeben hat“.
….
Ich gestehe, dass man gegen die Freiheit vorzügliche Argumente vorbringt; doch ebenso gute bringt man gegen die Existenz Gottes vor.
D. Literaturhinweise:
– Hellwig, Marion, Alles ist gut: Untersuchungen zur Geschichte einer Theodizee-Formel im 18. Jahrhundert in Deutschland, England und Frankreich. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008, 384 S. (Hellwig gibt einen hervorragenden Überblick über die Debatte im 18.Jahrhundert und die Positionen Voltaires, Rousseaus, Resnels, Bolingbrokes und u.v.a. zu Popes „Alles was ist, ist gut“ sowie über die eingereichten Arbeiten zur Preisfrage der Preußischen Akademie von 1753:
„Die Aufgabe besteht darin, das in der Aussage Popes (All whatever is, is right) enthaltene System zu untersuchen, insbesondere:
1. Zu bestimmen, was diese Aussage im Sinne des Autors bedeutet.
2. Sie zu vergleichen mit dem System des Optimismus, bzw. der bestmöglichen Welt, um genau die Unterschiede und die Beziehungen festzustellen.
3. Schließlich die Gründe anzuführen, von denen man glaubt, dass sie das System stützen oder aber vernichten.“- Rehlinghaus, Franziska, Zur Relevanz des Unverfügbaren zwischen Aufklärung und Erstem Weltkrieg, Göttingen: Vanderhoeck, 2015, 479 S. (beschäftigt sich vornehmlich mit der Geschichte des Schicksalsbegriffs in Deutschland)
– Zanconato, Alessandro, Le dispute du fatalisme en France 1740-1760, 2004, Paris : Université de Sorbonne, 755 p. (Stark von der Position Popes ausgehend. Verfolgt die Debatte unter dem Aspekt, wie nah oder fern ihr die einzelnen Protagonisten sind. Das Buch leidet am „Insidersprech“, oftmals typisch für eine Dissertationsschrift).
Die folgenden Anmerkungen zu einzelnen Textstellen beziehen sich mit ihren Seitenangaben auf die von uns bei Reclam herausgegebene Ausgabe des Philosophischen Taschenwörterbuchs (2020):
Anmerkung 1: (S.185-186, 1.Absatz): Voltaire folgt hier den Ausführungen von Pluquet, Examen du fatalisme (s.o.) ohne dessen Wertungen zu übernehmen. Dieses dreibändige Werk befand sich in seiner Bibliothek (s. dazu das online Verzeichnis bei www.c18.net)
Anmerkung 2 (S. 186, 2. Absatz, „Die Philosophen hatten niemals weder Homer noch die Pharisäer nötig.“): Dieser und die nächsten beiden Absätze zeigen Voltaire als Anhänger eines naturgesetzlichen Determinismus: „Alles ist geregelt, miteinander verknüpft und begrenzt“, darin den Positionen von Hume (aber auch von Spinoza und Pope) sehr nahe.
Anmerkung 3 (S.186, 6.Absatz, „Wenn Du das Schicksal einer Fliege durchkreuzen könntest … wärst Du mächtiger als Gott“)
Wer eine Fliege tötet, ändert ihr Leben in diesem einen Moment, nicht aber ihr gesamtes vorhergehendes Leben. .